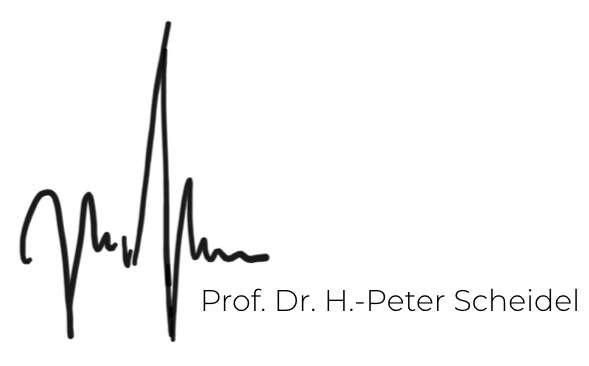Die ganz überwiegende Mehrheit der Deutschen vertraut der Wissenschaft. Nur jeder Zehnte gab bei einer Befragung an, der Wissenschaft “nicht” oder “eher nicht” zu vertrauen. Trotz der geringen Zahl der Skeptiker – die öffentlichen anti-wissenschaftlichen Stimmen von Klimaskeptikern und Corona-Verweigerern sind ein beachtetes Phänomen der Fake-News-Ära.
“Wissenschaftler sollten unbedingt in der Lage sein, hierzu eine Gegenstimme zu liefern”. Wenn dies nicht gelinge, liege das weniger an mangelnder Intelligenz der Bevölkerung, sondern eher an den Wissenschaftlern selbst, denen es nicht gelingt, ihre Themen allgemeinverständlich auszudrücken. Für Beatrice Lugger, Direktorin des Nationalen Instituts für Wissenschaftskommunikation (NaWik) in Karlsruhe bedeutet gute Wissenschaftskommunikation nicht nur, Forschungsergebnisse verständlich zu kommunizieren, sondern als Wissenschaftler mit der Bevölkerung direkt oder über die die Medien in einen Dialog zu treten.
“Die Wissenschaft ist ein zentraler Motor unserer Gesellschaft. Miteinander in den Dialog zu treten, ist daher wichtig.”
Beatrice Lugger
Forscher wissen am besten, wie Wissenschaft funktioniert, dass sie ein langsamer Prozess ist und sie ebenso aus Ergebnissen wie aus Scheitern besteht. Der Knackpunkt für gute Wissenschaftskommunikation scheint zu sein: Wissenschaftler müssen eine Übersetzungsarbeit aus der Fach- in die Alltagssprache leisten. Dabei müssen sie ihre Kernbotschaft bewahren. Zwar ist die Fachsprache gut und wichtig, ermöglicht doch sie erst den genauen Blick der Wissenschaft. Genauso wichtig sei es als Experte aber, die Detailversessenheit auf ein notwendiges Minimum reduzieren zu können, sodass der Inhalt noch richtig ist, die Aussage aber ohne fachsprachliches Wörterbuch verstanden werden kann. Wo niemand etwas versteht, könne das öffentliche Bild der Wissenschaften nicht gestärkt werden.
„Das größte Problem in der Geschichte der Menschheit ist, dass die, die Wahrheit kennen, den Mund nicht aufmachen. Und diejenigen, die von nichts eine Ahnung haben, bekommt man einfach nicht zum Schweigen.“
Dieter Hallervorden
Erfolgreiche Kommunikation heißt für Lugger: zielgruppengerechte Kommunikation. Dabei seien fünf Faktoren zu berücksichtigen: Wer ist meine Zielgruppe? Welcher Sprachstil ist passend? Welches Thema interessiert meine Zielgruppe? Welches Ziel verfolge ich? Welches Medium nutze ich dafür? Für den passenden Stil vermittelt das Institut zwölf einfache Regeln, die helfen, sich einfach auszudrücken. Auch viele Texter oder Journalisten richten sich danach. Die zwölf Stil-Regeln hat das NaWik in Form eines Kleeblatts visualisiert.

Um zu überprüfen, ob man die Regeln der klaren Kommunikation verinnerlicht hat, empfiehlt sie eine Art Probe:
“Man sollte in drei knackigen Sätzen formulieren können, woran man gerade arbeitet.”
Wer das schafft, hat seine Kernbotschaft gefunden. Bis es soweit ist, heißt es: Üben. Wenn es nach Lugger ginge, würde die Wissenschaftskommunikation zur curricularen Ausbildung eines Wissenschaftlers gehören.
Dass die Wissenschaftskommunikation noch starken Verbesserungsbedarf hat, darin ist sich Lugger sicher. Bisher liege die Hauptanstrengung meist in der institutionellen Kommunikation, also zwischen professionellen Öffentlichkeitsabteilungen und Kommunikatoren. Tatsächlich haben fast alle Universitäten und Institute heute gut funktionierende Öffentlichkeitsabteilungen. – innerhalb des Wissenschaftssystems gibt es bisher aber kaum Anerkennung für jene, die sich für die Wissenschaftskommunikation engagieren.
Auszüge eines Blogseminars der FAZ mit Beatrice Lugger, Nationales Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik).
Kommentar
Aus meiner Sicht ist der Beitrag mit Frau Lugger eine Bereicherung. Sie legt den Finger in eine offene Wunde. Viele Wissenschaftler und Experten würden sich über mehr Aufmerksamkeit für ihre Arbeit, ihr Wissen und ihre Einsichten in der Öffentlichkeit freuen. Sie scheitern meist nicht an sich selbst, sondern an den hohen Hürden, die bestehen, wenn man seine Aussagen einer größeren Öffentlichkeit präsentieren möchte. Der Begriff Post-truth („Post-Wahrheitspolitik“) wird definiert als „Bezeichnung von Umständen, unter denen objektive Fakten weniger Einfluss auf die Gestaltung der öffentlichen Meinung haben als Appelle an Emotionen und den persönlichen Glauben.“ Damit muss man als Wissenschaftler in einem defactualisierten Umfeld erst mal klarkommen.
Ein guter Weg. Menschen zu erreichen, ist die von Lugger vorgeschlagene zielgruppenorientierte Kommunikation. Im Wesentlichen basiert diese Empfehlung auf den bereits von Aristoteles formulierten Regeln der erfolgreichen Rhetorik. Die wichtigste Regel wird jedoch nicht genannt: Sei alterozentriert. Nach meiner Erfahrung fällt das Wissenschaftler besonders schwer. Sie fokussieren oft zu stark auf ihre eigene Leistung. Die Öffentlichkeit fragt: “What´s in for me?“
Welches Medium nutze ich dafür? Bei der mittlerweile unüberschaubaren Zahl von Medienkanälen und -plattformen geht selbst hochqualitative Wissenschaftskommunikation oft in der Masse an Informationen verloren. Hier braucht es meist professionelle Unterstützung, um die Anstrengungen nicht wirkungslos verpuffen zu lassen.
Üben. Ja man kann die Regeln einer verständlichen Wissenschaftskommunikation lernen. Schlussendlich sind jedoch drei Faktoren unentbehrlich: Talent, Spaß an der Sache und manchmal auch die Bereitschaft sich zu quälen.
„Auch wenn Journalisten keine eigenen Gedanken haben erhöhen sie wenigstens die Umlaufgeschwindigkeit fremder Gedanken.“
Rudolf Gerhardt
Worüber Frau Lugger nicht spricht: Wer sich in die Öffentlichkeit begibt, geht ein hohes Risiko ein. Im Feuer der Öffentlichkeit kann man sich leicht ein paar Brandblasen einfangen. Jede einzelne Aussage wird überkritisch geprüft, gern werden Wissenschaftler unabsichtlich, nicht selten auch absichtlich missverstanden. Der kollegiale Dialog wird in der Öffentlichkeit zum Streitgespräch. Medien gieren geradezu nach Wissenschaftlern, die Aussagen ihrer Kollegen in Frage stellen. Es ist leicht, jemand zu finden, der dagegen ist. Das rationale „audiatur et altera pars“ („Man höre auch die andere Seite“) wird als Instrument der Wahrheitsfindung ersetzt durch ein überwiegend emotional geprägtes Gegenszenario. Um den Unterhaltungseffekt der Auseinandersetzung zu steigern, schrecken Medien selbst vor falschen Zitaten und böswilligen Attacken gegen kritische Mahner nicht zurück.
Wer es sich nicht leicht macht, hat es nicht leicht. Kurt Tucholsky hat dies erlebt. Er sprach, schrieb und zuletzt schwieg er.